Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie, der Netzwerke und der Endgeräte ist es in den letzten Jahren deutlich einfacher geworden, Lerninhalte in Form von Videos zu erstellen, zu distribuieren und zu nutzen bzw. zu verarbeiten. Video-basiertes Lehren und Lernen gilt als ein wichtiger Trend im Bereich des Technologie-unterstützten Lehrens und Lernens. Videos stehen im Ruf, attraktive und wertvolle Lernmaterialien zu sein.
“Illusion des Lernens”
Studien im Bereich der Rezeptionsforschung zur Nutzung von Videos als Lernmaterialien ab Mitte der 1970er Jahre zeigen, dass die Inhalte aus Videosequenzen, die gezielt zur Informationsaufnahme angesehen werden, später nur zu einem geringen Teil erinnert werden können (ca. 20%). Dies gilt auch dann, wenn die Betrachter angeben, dass sie den Inhalten problemlos folgen konnten. Zudem zeigen weitere Studien dass Lernende, die Inhalte per Video aufgenommen haben, ihr Wissen höher einschätzen als Lernende, die den gleichen Stoff anhand von Texten erarbeitet haben. Dieser Sachverhalt wird als “illusion of knowing”, als Lücke zwischen dem reinen Aufnehmen von Informationen und dem vermeintlichen Verstehen sowie dem nur bruchstückhaften Erinnern und Wiedergeben von Inhalten bezeichnet.
Lernvideos sind für Lernende also scheinbar leichter zugänglich als Texte. Zuhören und Zusehen ist subjektiv leichter als Lesen. Textverarbeitung erfordert mehr Anstrengung und Eigentätigkeit beim Erschliessen der Inhalte. Zumindest dann, wenn es um die Vermittlung von Informationen geht (“know that”) besteht also die Gefahr, dass das Lernen mit Videomaterialien zu schlechteren Ergebnissen bei Wissensabfragen führt als das Lernen mit Texten (Pfeiffer 2015, S. 1-2).
Detailreichtum als Überforderung?
Im Unterschied zu Animationen, die bei Bedarf in einer abstrahierenden oder schmematisierenden Weise umgesetzt werden können, liefern Videos viele Details und weisen einen hohen Realitätsgrad auf. Lernende stehen daher vor der Aufgabe, aus der Fülle der Informationen im Video die lernzielrelevanten Informationen herauszufiltern – was insbesondere für mit geringem Vorwissen eine grosse Herausforderung darstellen kann (Niegemann et al. 2008, S. 265).
Wann machen Videos als Lernressourcen Sinn?
Lernvideos sind keine Garantie für erfolgreiches Lernen und werden textbasierte Formen der Wissensvermittlung nicht ersetzen. Aber sie ergänzen und bereichern unser Repertoire an verschiedenen Lernformen und bieten die Möglichkeit für Abwechslung. Die technischen Entwicklungen, die es immer leichter machen, Lernvideos zu erstellen, sind aus folgenden Gründen zu begrüssen:
- Lernende können Inhalte dann rezipieren / bearbeiten, wenn es für sie selbst zeitlich gut passt (nicht notwendigerweise dann, wenn die Vorlesung stattfindet).
- Lernende können im Inhalt navigieren (Vor- / Zurückspulen)
und, so kann man ergänzen, je nach verwendetem Player auch das Wiedergabetempo anpassen sowie
aussagekräftige Einzelbilder für Dokumentationen in Lerntagebüchern oder Notizheften abspeichern. - Lehrende können Personen jenseits eines Hörsaals / Seminarraums erreichen.
Lernvideos sind insbesondere für die folgenden Zielsetzungen gut geeignet:
- Zum Einführen von Themen.
- Zum Darstellen bzw. Aufnehmen (Nachvollziehen) von Sachverhalten, die sich dynamisch entwickeln (z.B. bestimmte Arbeitsverrichtungen, Verhaltensmuster, die Entwicklung einer mathematischen Formel, Erfahrungsberichte, etc.).
- Zum Personalisieren und damit auch zum Kontextualisieren von Lerninhalten; Persönlichkeit, Stil und emotionaler Bezug zu einem Thema kommen in einem Video anders zum Tragen als bei einer textuellen Vermittlung der gleichen Inhalte in einem Skript oder Lehrbuch (Schwan 2014).
Aspekte der Mediengestaltung
Welche Aspekte der Mediengestaltung sind zu beachten? Hier können handwerkliche Qualität, Interaktivität, Personalisierung, Sichtbarkeit von (Hand-)Bewegungen und technische Aspekte unterschieden werden.
Handwerkliche Qualität
- Das Erreichen einer möglichst guten Qualität von Bild und Ton; handwerklich schlecht gemachte Videos (unpassende Perspektive, wackeliges Bild, schlechte Lichtverhältnisse, schlechte Tonqualität) können die Aufnahme der Inhalte deutlich erschweren;
- Eine gute Passung von Tonspur und Bildspur (z.B. Bearbeitung eines Werkstücks mit entsprechenden Arbeitsgeräuschen) ohne Redundanz (im Sinne einer doppelte Kodierung von Informationen in Bild und gesprochenem Kommmentar); fehlt die Passung von Bild und Ton, wird es für Rezipienten verwirrend und es ist sinnvoller z.B. durch Schliessen der Augen nur einem In-formationskanal zu folgen; redundante Informationsdarbietung andererseits erhöht die kognitive Belastung und kann das Lernen beeinträchtigen;
- Das richtige Tempo (nicht zu langsam / langweilig und nicht zu schnell bzw. verdichtet).
Interaktivität
Digitale Videos bieten mehr Möglichkeiten für Interaktion mit dem Medium und den Inhalten als analoge Videos. Neben Starten, Stoppen, Zurück- / Vorspulen (Mikrointeraktivität) ist es auch möglich, über Kapitelmarken eine Gliederung vorzunehmen und verschiedene Einstiegs- / Ausstiegspunkte übersichtlich anzubieten, Hyperlinks auf andere Materialien einzufügen, etc. (Makrointeraktivität).
Personalisierung
Lernvideos werden in verschiedenen Varianten erstellt. Bekannt sind etwa das “Khan-Style-Video” (Khan Academy), bei dem die Lehrperson nicht sichtbar ist, sondern lediglich der von der Lehrperson entwickelte Inhalt:
(Bildquelle: Khan Academy)
Eine andere Variante sind Videos, bei denen die Lehrperson (oder die Fachexperten etc.) im Bild zu sehen sind und zu den Betrachtern sprechen:
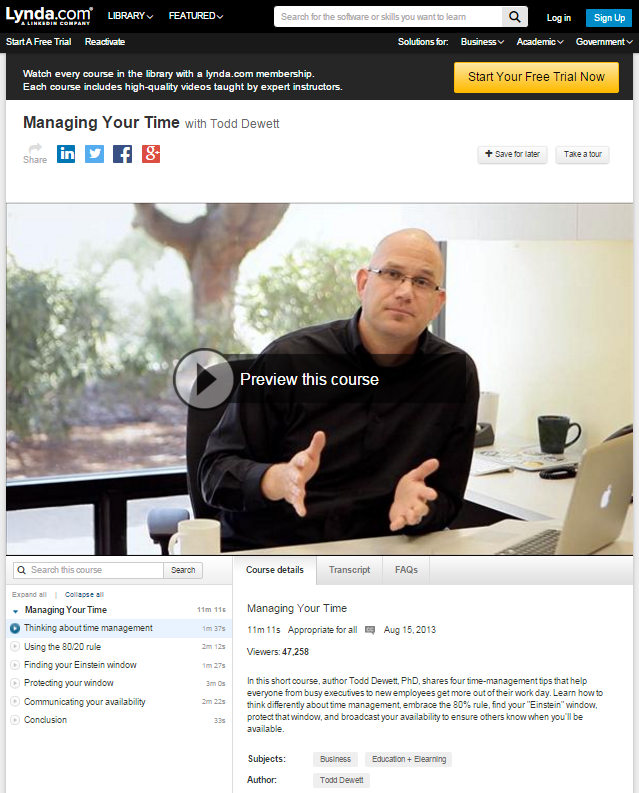
Schliesslich gibt es noch Varianten, bei denen sowohl die Lehrperson als auch Lerninhalte im Bild zu sehen sind:
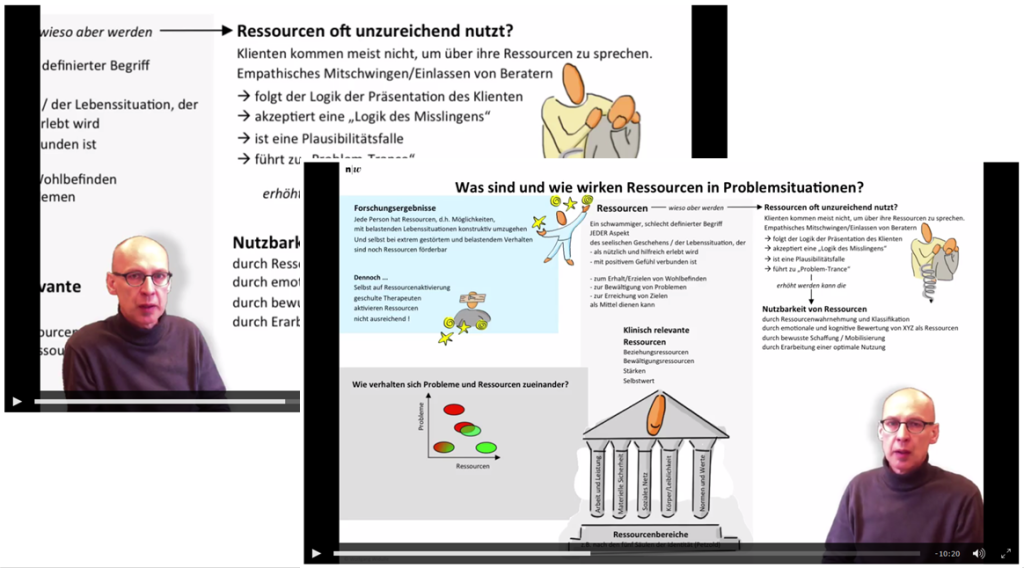
Sichtbarkeit von Bewegungen
Bei der Entwicklung von MOOCs wird gegenwärtig mit vielen unterschiedlichen Darstellungsformaten experimentiert. Studien haben gezeigt, dass auch die Sichtbarkeit menschlicher Bewegungen das Aufnehmen und Verarbeiten der Inhalte bzw. Informationen positiv beeinflusst. Der aktuelle Forschungsstand spricht dafür, beim Erstellen von Lernvideos beispielsweise eine schreibende Hand im Bild zu belassen (Schwan 2014).
Technische Aspekte
Die Lernmedien bzw. die verwendeten Datenformate, Applikationen und Systeme müssen folgendes unterstützen:
- das reibungslose Abspielen (inkl. Stoppen, Zurückfahren, Neu-Starten);
- die Möglichkeit, Video herunter zu laden und lokal vom Endgerät abzuspielen;
- die Verfügbarkeit von Video auf verschiedenen Endgeräten (PC, Notebook, Tablet, Smartphone) – je nach Nutzungssituation (Pfeiffer 2015, S. 3).
Gestaltung von Lernarrangements für eine zielführende Nutzung von Videos
Neben der Gestaltung der videobasierten Lernmedien im engeren Sinn muss auch das umfassendere Lernarrangement so gestaltet werden, dass Videos gewinnbringend genutzt werden können. Drei hierbei besonders wichtige Aspekte können herausgestellt werden:
- Anleitung bzw. Instruktionen für die Lernenden
Worum geht es im Video? Was soll damit gemacht werden? Was ist der Bearbeitungsauftrag? - Interaktion
Möglichkeiten der Interaktion mit Videomaterialien (z.B. Video stoppen, kurz zurückspulen und wieder abspielen; eingebettete Fragen beantworten; Kommentare zu bestimmten Passagen abgeben) erhöhen den Erfolg beim Lernen mit Video (Pfeiffer 2015, S. 3). - Trainieren des Umgangs mit Lernvideos
Ein vorgängiges Trainieren des Lernens bzw. Arbeitens mit Videomaterialien (z.B. zur Nutzung von Interaktions- und Navigationsmöglichkeiten) unterstützt den Lernerfolg der Lernenden (Schwan 2014).
Referenzen:
Niegemann, H. M., Domagk, S., Hessel, S., Hein, A., Hupfer, M., & Zobel, A. (2008). Kompendium multimediales Lernen. Springer Berlin Heidelberg.
Pfeiffer, Anke (2015): Inverted Classroom und Lernen durch Lehren mit Videotutorials: Vergleich zweier videobasierter Lehrkonzepte. e-teaching.org
Schwan, Stephan (2014): Lernen mit Videos – die Perspektive der Forschung. Interview. e-teaching.org
Weitere Ressourcen:
e-teaching.org, Themenspecial “Lehren und Lernen mit Videos”
Lieber Christoph, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag: Bewertes und Neues kombinieren und in der richtigen “Dosis”.
Beste Grüsse
Bruno Wicki, Schindler Berufsbildung
Stimmt alles, super-wertvoller Beitrag – nur viel zu kompliziert. Das schaffen ganz normale SeklehrerInnen nie.
Nun, Lernvideos müssen ja nicht immer selbst erstellt werden – es gibt ja Ressourcen im Netz, die sinnvoll eingesetzt werden können. Ich denke, es ist schon viel gewonnen, wenn Lehrpersonen zu einigen der hier angeführten Aspekten sensibilisiert sind und insbesondere die zuletzt genannten Punkte beachten: Üben des Umgangs mit Videos als Lernmedien und konkrete Aufträge zur Bearbeitung.
Sie haben das sehr schön Beschrieben Herr Meier. Natürlich sollte man nicht immer an alte Prinzipien festhalten, sondern neue Wege einschlagen. Auch in der Berufsbildung!
Freundliche Grüsse,
Arsim Murtezi
Toller und wertvoller Beitrag.
Anbei meine diesjährige Vorgehensweise, um meine Schüler an das Arbeiten mit Erklärvideos zu gewöhnen.
http://www.umgedrehterunterricht.de/die-flipgewoehnung-heranfuehrung-an-das-arbeiten-mit-erklaervideos/
Herzliche Grüße
Sebastian Stoll