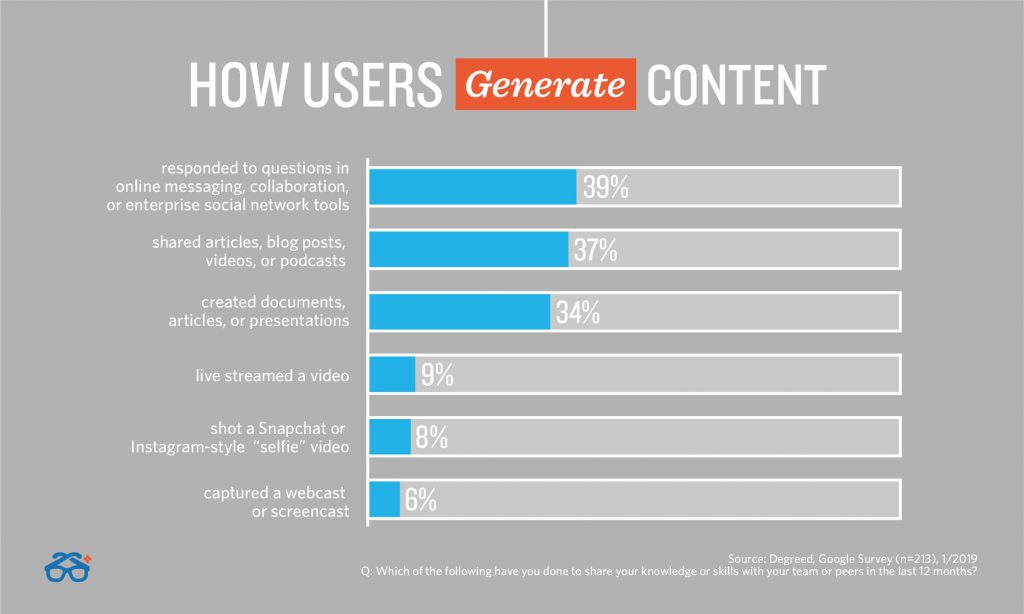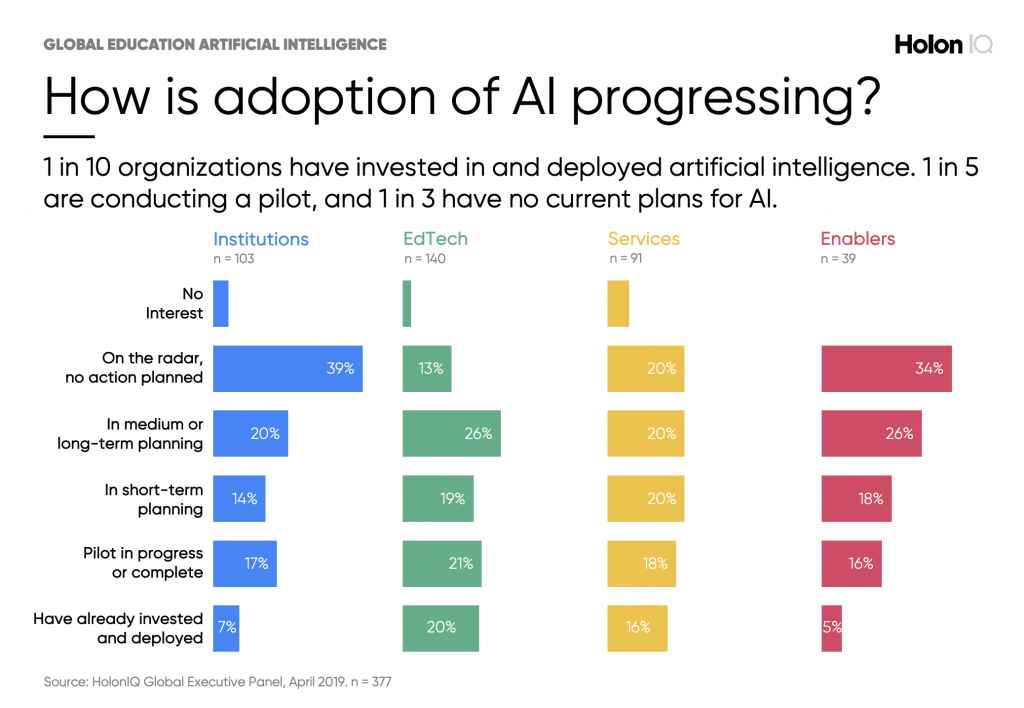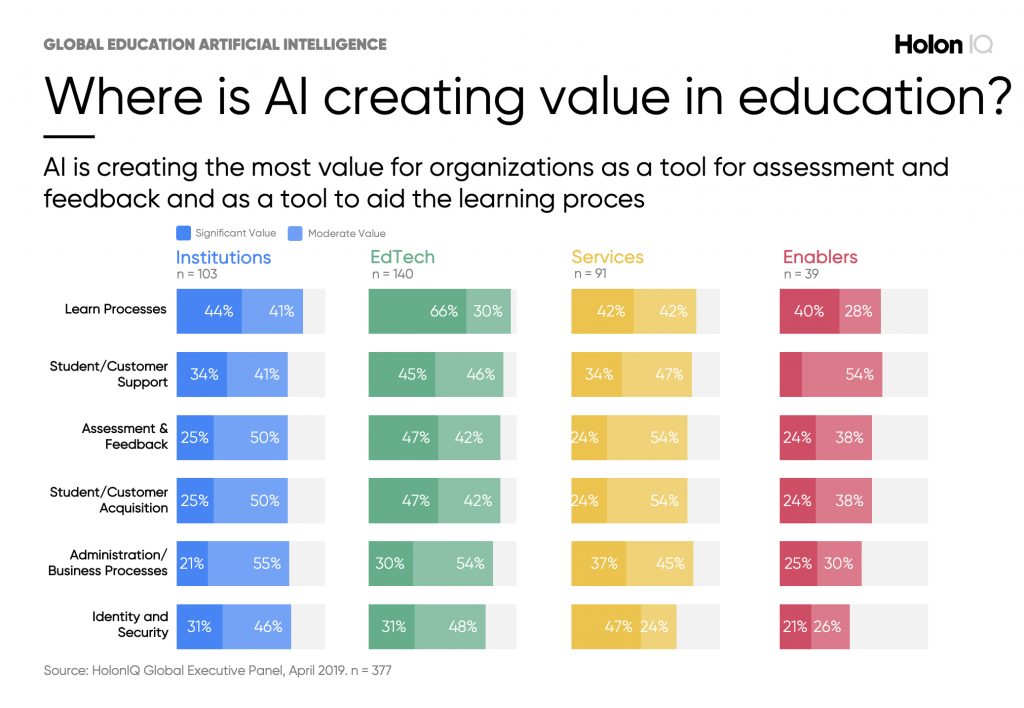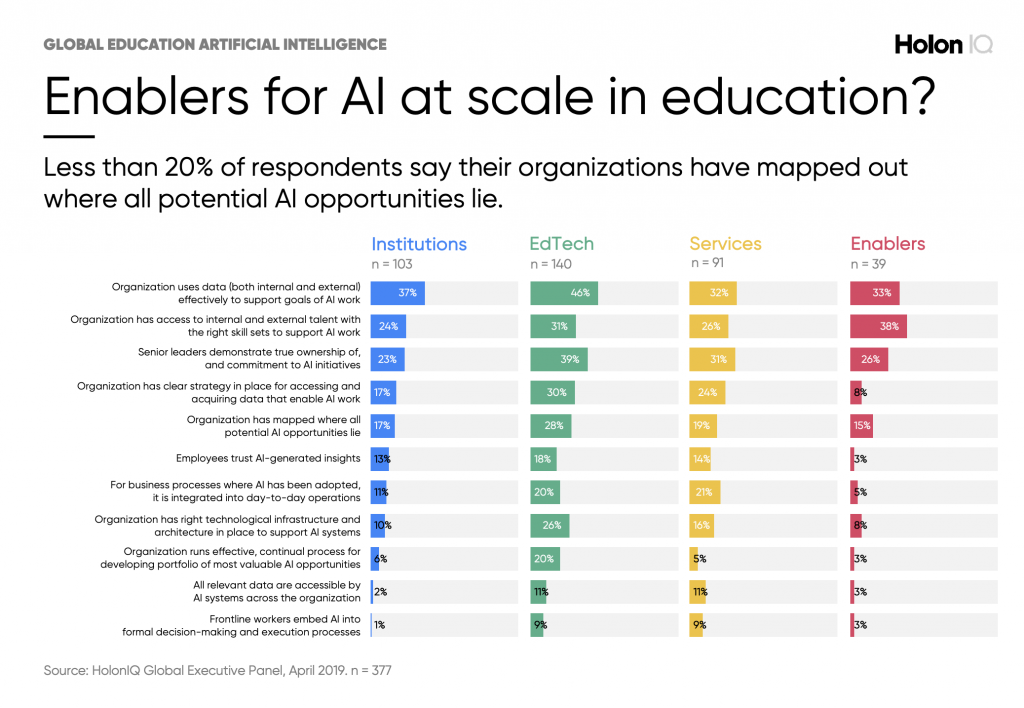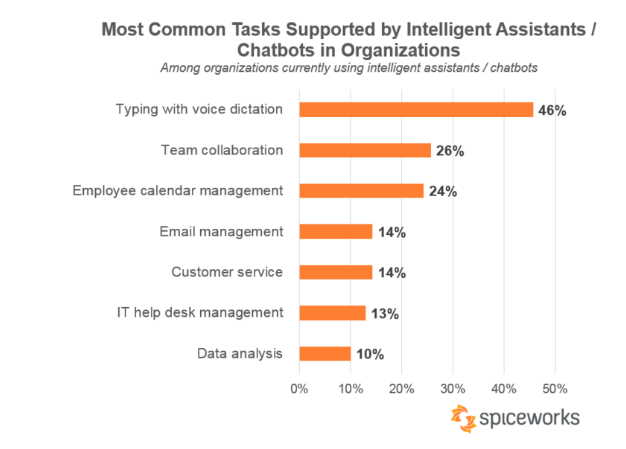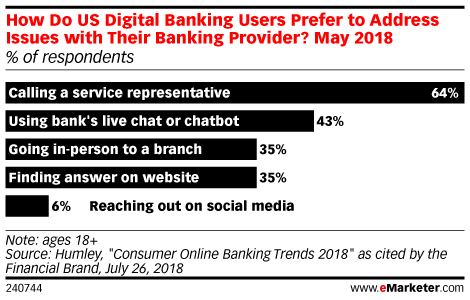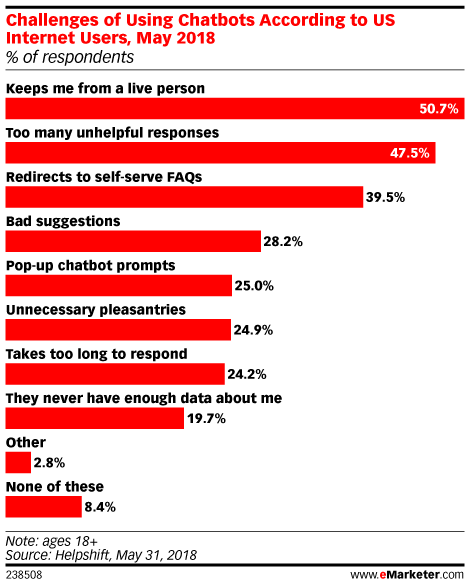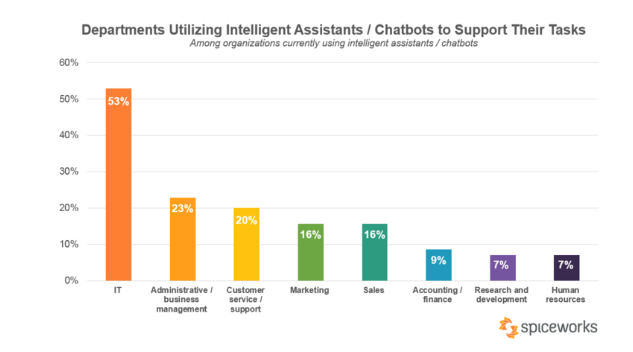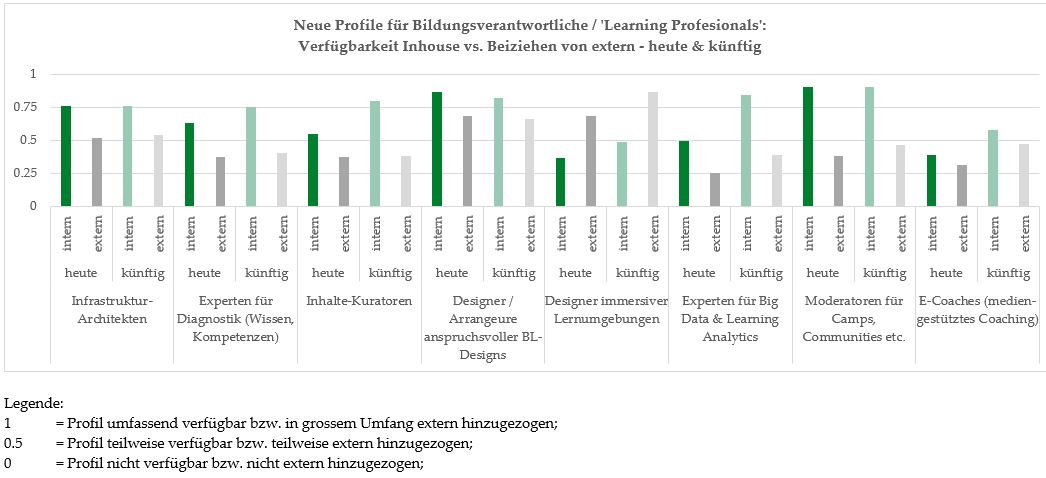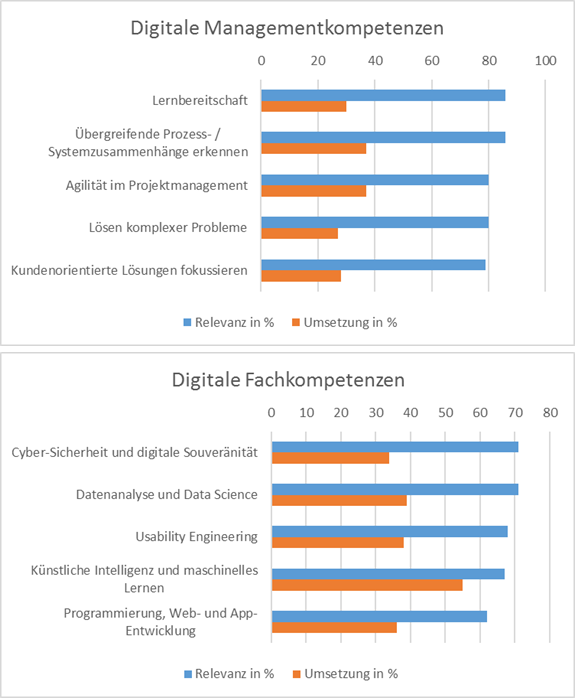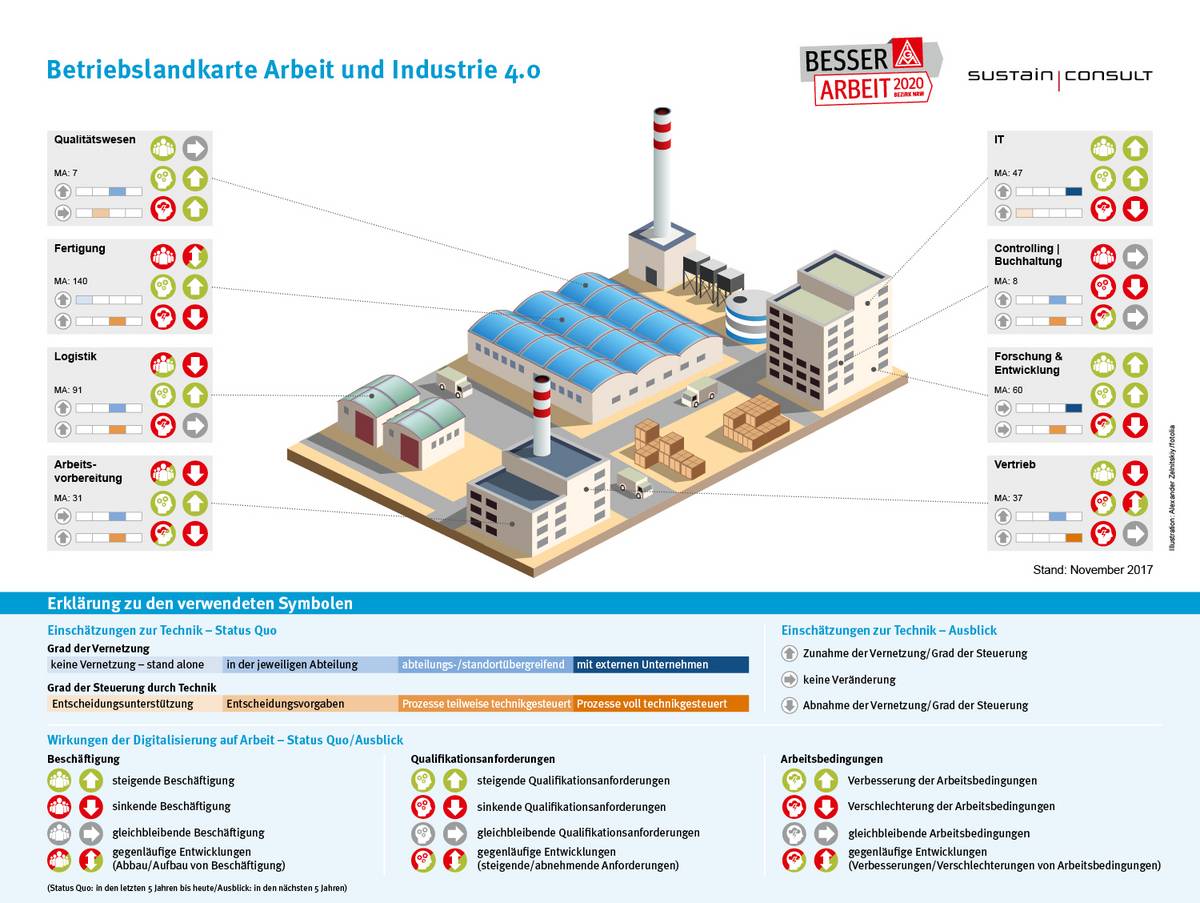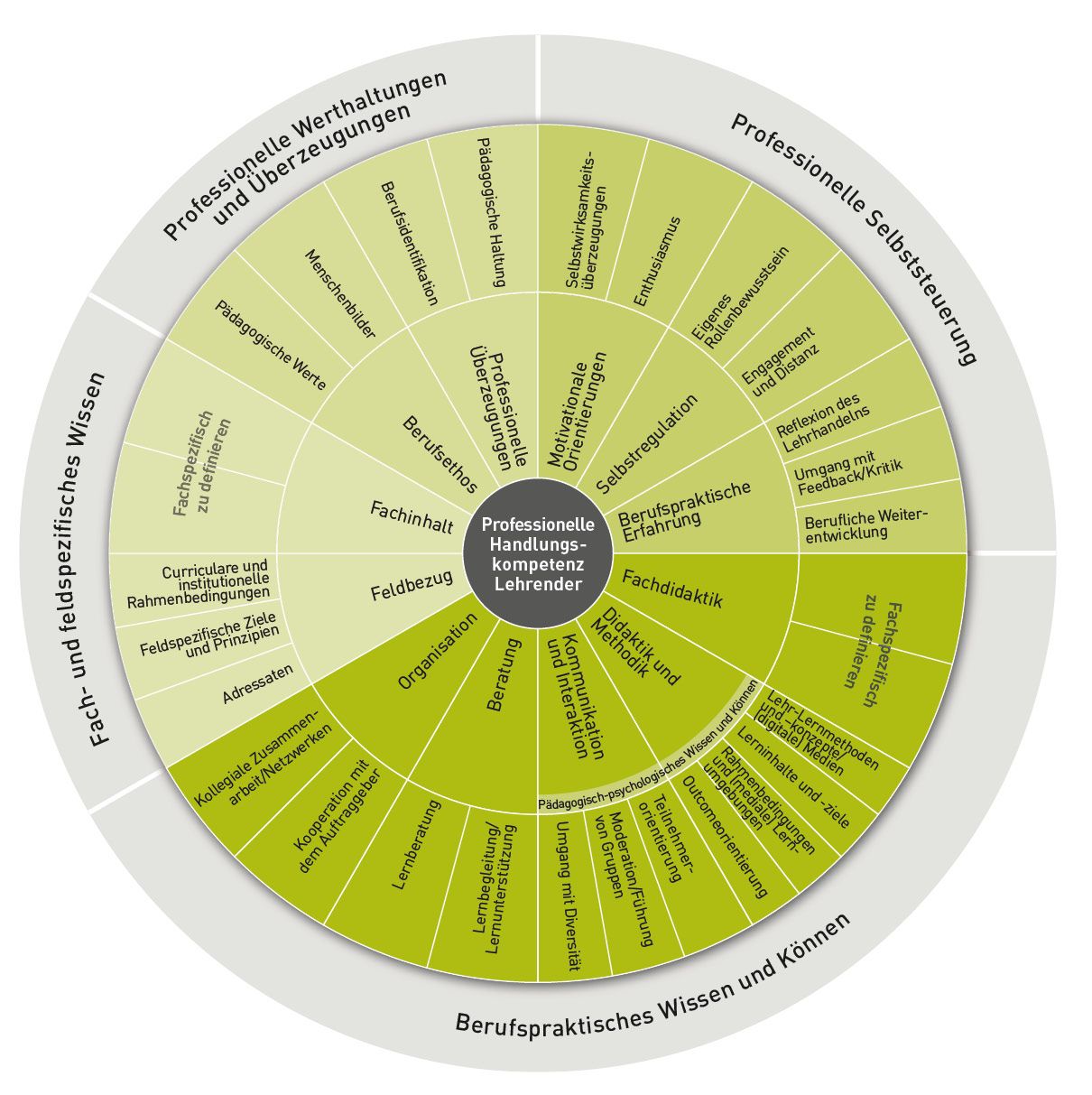Will Thalheimer, Massachusetts, USA, ist der Kopf von Work-Learning Research, Inc. In den letzten Jahren hat er seinen Fokus auf die Evaluation von Learning & Development / Personalentwicklung gelegt und in Abgrenzung zu Kirkpatrick ein 8-stufiges “Learning Transfer Evaluation Model” entwickelt (dazu mehr in diesem Post).
In seinem Blog hat er vor einigen Tagen eine aktuelle qualitative Studie zur Evaluation des 70:20:10-Ansatzes in der Personalentwicklung zusammengefasst: “The 70:20-10 Framework gets its first scientific investigation”.
Zur Erinnerung: dem 70:20:10-Modell zufolge erfolgt der grösste Teil von Lernen und Kompetenzentwicklung durch die Bearbeitung von herausfordernden Aufgabenstellungen im Prozess der Arbeit bzw. am Arbeitsplatz (inkl. Ausprobieren und Reflektieren). Ein weiterer wichtiger “Lernort” ist das soziale Lernen im Rahmen von Zusammenarbeit und Austausch mit anderen (inkl. Netzwerken, Mentoring und Feedback). Und nur ein kleiner Anteil des Lernens erfolgt im Rahmen von formal organisiertem Lernen (z.B. Trainings und Entwicklungsprogramme). Mehr dazu z.B. auf den Webseiten des 702010-Instituts (gegründet von Jos Arets, Vivian Heijnen und Charles Jennings).
Nun zu der aktuellen Studie, die in Australien durchgeführt wurde. Die Datenerhebung erfolgte in drei Phasen (vgl. Johnson et al. 2018):
- Teilstrukturierte Einzelinterviews mit fünf hochrangigen Vertretern eines Bereichs der australischen Bundesverwaltung zur Identifikation von Organisationseinheiten, in denen das 70:20:10-Modell als Leitlinie für die Personalentwicklung genutzt wird. Im Verlauf dieser Interviews wurden die Gesprächspartner auch nach ihrer Einschätzung der Umsetzung des Modells gefragt.
- Teilstrukturierte Einzelinterviews mit insgesamt 18 Vertretern des mittleren Managements dieser Einheiten zur Klärung von deren Sicht auf die eigenen Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des 70:20:10-Modells.
- 13 teilstrukturierte Gruppeninterviews mit insgesamt 122 Vertretern verschiedener Bundesbehörden der Teilstaaten Victoriy, Queensland und Northern Territory.
Die aufgezeichneten Gespräche wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Autoren fassen ihre Ergebnisse wie folgt zusammen:
Using a large qualitative data set that enabled the exploration of participant perspectives and experiences of using the 70:20:10 framework in situ, we found that, despite many Australian public sector organizations implementing the framework, to date it is failing to deliver desired learning transfer results.
(Johnson et al., 2018, S. 397)
Für diese fehlende Wirksamkeit werden insbesondere vier Missverständnisse verantwortlich gemacht:
First, there is an overconfident assumption that unstructured experiential learning will automatically result in capability development. Second, there is a narrow interpretation of social learning and a failure to recognize the role social learning has in integrating experiential, social, and formal learning. Third, there is an expectation that managerial behavior would automatically change following formal training and development activities without the need to actively support the process. The fourth and, in terms of theory most important, is a lack of recognition of the requirement of a planned and integrated relationship between experiential, social and formal learning for there to be effective learning transfer.
(Johnson et al., 2018, S. 394-395)
Ein 70:20:10-Modell führt also nicht automatisch zu erfolgreicher Kompetenzentwicklung. Die vier Herausforderungen bzw. Hindernisse für erfolgreiche Kompetenzentwicklung sind die folgenden:
1) Unkritisches Vertrauen darauf, dass Erfahrungslernen am Arbeitsplatz zu der gewünschten Kompetenzentwicklung führt. Für erfolgreiche Kompetenzentwicklung in diesem Modus braucht es Strukturen, Begleitung, Feedback, Unterstützung bei der Reflexion von Lernerfahrungen und Möglichkeiten, Neues anzuwenden:
“… people are learning really bad behaviors on the job…we actually have no capability or capacity to direct that learning in the direction we want it to be”
“for experiential learning to lead to effective capability development, it needs to be structured and overtly managed through regular and effective feedback, supporting ongoing personal reflection. It also requires the opportunity to repeatedly apply new skills to ensure capability is maintained”
2) Vernachlässigung der Bedeutung von sozialem Lernen im Sinne von Bandura (1977) – Lernen durch Beobachtung, Imitation und Orientierung an Vorbildern:
“Our findings indicate that, within these Australian public sector organizations, social learning is seen as occurring predominately through coaching, mentoring and networking activities. (…) we found [that] the effectiveness of the 70:20:10 framework is undermined by a lack of recognition of social learning as occurring through every day behavioral observation and role modeling of other managers.”
3) Die Erwartung, dass eine Beteiligung an formal organisiertem Training automatisch in Kompetenzentwicklung resultiert – auch ohne sorgfältige Gestaltung im Hinblick auf Transferorientierung:
“our findings indicate (…) that there are insufficient opportunities to practice new skills and apply new knowledge learnt through formal training, therefore, reducing the effectiveness of the 70:20:10 framework to transfer learning and develop managerial capability.
4) Fehlende Integration der drei für das 70:20:10-Modell konstitutiven Elemente.
Die Autoren der Studie leiten daraus folgenden Schluss ab:
Damit Personalentwicklung im Rahmen eines 70:20:10-Modells zu nachhaltiger Kompetenzentwicklung führt, müssen die drei konstitutiven Elemente (Erfahrungslernen durch praktische Arbeit, soziales Lernen im Austausch mit und durch Nachahmung von anderen, formal organisiertes Lernen im Rahmen von Trainings und Programmen) in einem kohärenten Gesamtdesign integriert werden. Nachhaltig wirksame Kompetenzentwicklung erfordert, dass formal organisierte Trainingsprogramme in eine übergreifende Struktur eingebettet werden, die soziales Lernen (u.a. Nachahmung von Vorbildern, Coaching, Mentoring) ebenso umfasst wie eine Arbeitsumgebung, in der Neues ausprobiert werden kann.
Johnson, Samantha J.; Blackman, Deborah A.; Buick, Fiona (2018): The 70:20:10 framework and the transfer of learning. In: Human Resource Development Quarterly 29 (4), S. 383–402. DOI: 10.1002/hrdq.21330 .